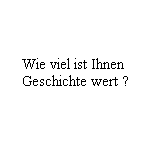Version LX
GEOGRAFIE
Provinzen

![]() GEOGRAFIE
GEOGRAFIE
![]() VORGESCHICHTE
VORGESCHICHTE
![]() EROBERUNG
EROBERUNG
![]() VERWALTUNG
VERWALTUNG
![]() MILITÄR
MILITÄR
![]() WIRTSCHAFT
WIRTSCHAFT
![]() RELIGION
RELIGION
![]() SPÄTANTIKE
SPÄTANTIKE
![]() NACHFOLGER
NACHFOLGER
zurück zu den
germanischen Provinzen
Religion
Mit der Eroberung durch die Römer kamen auch deren religiösen Vorstellungen in die germanischen Provinzen. Die Methode, einheimische Gottheiten und Kulte dem griechisch-römischen Pantheon anzugleichen führte zu einem komplexen religiösen Gesamtbild.
Grosser
Beliebtheit erfreute sich Merkur, da er zahlreiche Funktionen in sich
vereinigte. So wurde er von den antiken Schriftstellern mit den
unterschiedlichsten einheimischen Gottheiten (Wotan, Teutates, Esus,
etc.) verschmolzen. Im Zweifelsfall kombinierte man einfach die Namen
beider Götter, wie bei Mercurius Gabrinius, einer Mischung aus
Merkur
und dem in der Bonner Gegend verehrten Gebrinius.
Seit
63 v.Chr. stand in Rom auf dem Kapitolhügel eine Säule mit dem
thronenden Iuppiter. Sie wurde seit der Zeit
Neros vor allem in den
germanischen und nordgallischen Provinzen nachgeahmt. Besonders am
Land waren derartige Iuppitersäulen üblich. Eine Besonderheit des
ostgallischen Raumes waren Säulen mit dem Bild des reitenden
Himmelsgottes samt eines sich ergebenden (oder niedergerittenen)
Giganten. Hier mischte sich die römische Religion mit der
einheimischen. Taranus, dessen Symbol auch das Rad war, und der laut
Überlieferung in Form einer Eiche verehrt wurde, glich sich dem
Iuppiter an. Die Angleichung der Götterwelten erfolgte keineswegs
unter Zwang oder einseitig von den Römern aus. Sie vollzog sich in
beiderseitigem Einvernehmen und zeigt auch die Ähnlichkeiten in
vielen Kulten auf.
Neben der kapitolinischen Trias (Iuppiter, Iuno und Minerva) und Merkur spielten die anderen Götter des römischen Pantheons eine eher untergeordnete Rolle. Bekannte Kultstätten galten Aesculapius, Vesta, Pluto, Proserpina, Neptunus und Ceres. Sie alle wurden nicht mit einheimischen Göttern verschmolzen.
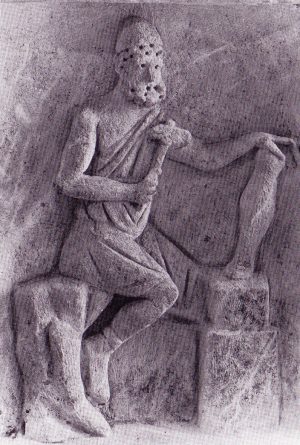

links:
Volcanus auf dem Sockel einer Iuppitersäule, Köln-Weiden,
2./3.Jh.n.Chr.
rechts: Bronzestatuette des Mars, Pommern/Mosel, 2./3.Jh.n.Chr.
e libro [habe ich mir leider nicht vermerkt...]
Mars
hingegen erfuhr wiederum eine Angleichung; etwa als Mars Halamardus
oder Mars Camulus. Mit Victoria und Hercules wurde ähnlich verfahren.
Letzterer galt bei den Germanen als römische Version des Donar.
Hercules Saxanus (=der felsenharte) war der Schutzpatron der Arbeiter in den
Steinbrüchen.
Apollo wurde vor allem als Heil- und Gesundheitsgott verehrt und verschmolz in dieser Funktion mit dem einheimischen Grannus, der schon Heilquellen seinen Namen verliehen hatte (Aquae Granni). Ihm zur Seite gestellt waren manchmal Sanus (Gesundheitsgöttin), Diana (als waldbetonte Jagdgöttin) und Silvanus (als Gott der Wälder und Fluren). Der Bärenfänger Cessorinius stiftete letzterem in Vetera (Xanten/D) eine Statue. Dem Volcanus entsprach ein lokaler Gott, die namentlich nicht überliefert wurde, den Attributen nach aber als Schlägel- und Hammergottheit bezeichnet wird. Fortuna wurde in zahlreiche Statuetten geformt und galt als Heilgöttin im Gefolge des Apollo. Sie beschützte in Untergermanien öffentliche Bäder. Der Schwerpunkt der Venusverehrung lag nicht in ihrer Funktion als Liebesgöttin, sondern in ihrem breiten einheimischen Bogen als Muttergottheit.
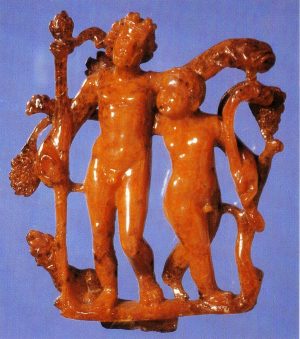

links:
Bacchus & ein Satyr in rötlichem Bernstein, 1.Hälfte 3.Jh.n.Chr.
rechts: Bronzestatuette der Victoria, Xanten, 2./3.Jh.n.Chr.
e libro [habe ich mir leider nicht vermerkt...]
An
Numen geografischer Begriffe gab es in der Provinz vor allem Rhenus
(den Rhein) und Rura (die Rur). Dazu kamen noch Abnoba bzw.
Arduinna
(die Göttinnen des Schwarzwaldes und der Ardennen).
An
Altären sind noch bekannt Fama (Leumund), Fatae (unheilvolles
Schicksal), Honos (Ehre) und Favor (Gunst). Speziell hervorzuheben
sind noch Sors Classicana (das Schicksal der Rheinflotte) und Dea
Virtus (die personifizierte Tapferkeit)
Der
einer Gottheit geweihte Orte hiess Fanum (manchmal auch Cella). Rein römische
Götter wurden mit klassisch-römischen Bauwerken verehrt. Die
einheimischen Tempel hatten hingegen ein anderes Aussehen. Die Cella
bestand aus einem turmartigen Gebäude mit zwei Stockwerken und einem
offen Säulengang rundum. Ein solches Heiligtum wird als „gallo-römischer
Übergangstempel“ bezeichnet. Diese Bauform wurde in der ganzen
Provinz zahlreich ergraben. Tempelanlagen in einheimischem Stil
beherbergten oft mütterliche Segens- und Fruchtbarkeitsgöttinnen.
Die Matronen von Oberitalien bis Britannien weihten dort ihre Gaben
meist drei Muttergottheiten. Ihre Namensvielfalt ist sehr gross (über
100) mit eingeschränkter regionaler Kultbedeutung.
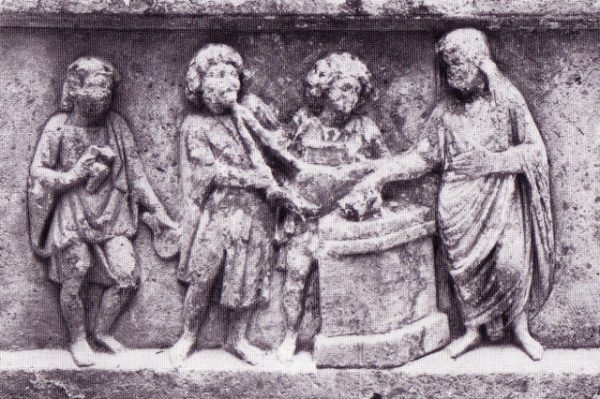
Opferszene auf
einem Weihealtar, Bonn, 2./3.Jh.n.Chr.
e libro (habe ich mir leider nicht vermerkt...)
Die
Zahl der einheimischen Gottheiten, die nicht mit dem römischen
Pantheon in Verbindung gebracht wurde, blieb indes ebenfalls nicht
unerheblich. Dies bedeutet aber zugleich, dass über ihre Namen und
Funktionen kaum etwas überliefert wurde. Bekannt sind etwa
Requaliuahanus, Varneno, Hludana, Hurstrga, Iseneucaega, viradegdis,
Apadeua oder Sandravdiga. Für sie alle sind Cultores Templi
(Tempelpfleger) bezeugt. Sunux(s)al gilt als Stammesmutter der Sunuci,
die wohl in der Umgebung von Aachen beheimatet waren. Von überregionaler
Bedeutung scheint Vagavercustis gewesen zu sein, da ihr sogar ein römische
Prätorianerpräfekt einen Altar stiftete.
Bessere
Überlieferungen gibt es bei Epona, der Schutzgöttin der Reisenden,
Zug-, Last- und Reittiere, ihrer Führer, Stallungen und Unterkünfte.
Epona wurde ursprünglich in Tiergestalt als Stute verehrt, bevor sie
unter römischem Einfluss zur Reitergöttin mutierte; dargestellt
zwischen zwei Pferden oder Maultieren sitzend, die ihr aus der Hand
frassen oder reitend im Damensattel und mit der Mähne in der Hand.
Als keltische Göttin besass sie provinzübergreifende Bedeutung von
Germanien über Gallien, die Donauprovinzen bis hin zu Oberitalien und
sogar Rom selbst.
Ebenfalls
gut bekannt ist Nehalennia, eine Beschützerin der Kaufleuten und Händler
die entlang des Rheins bis nach Britannien schipperten.
Die
Britannienkaufleute schworen bei Nehalennia vor der Abfahrt einen
Altar für den Fall zu setzen, falls die Überfahrt gelänge und die
Waren sicher in Londinium (London/GB) ankämen.
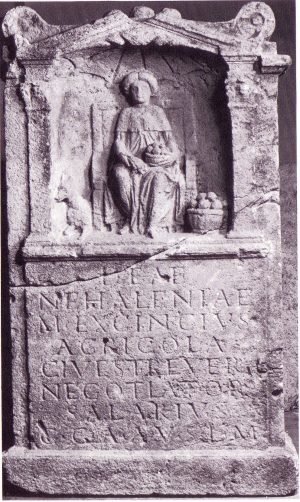
Weihealtar
der Nehalennia, um 200 n.Chr.
e libro (habe ich mir leider nicht vermerkt...)
Mit
den römischen Göttern hielten auch orientalische
Mysterienkulte Einzug in den germanischen Provinzen. Der
Kybele-Kult ist durch das Taurobolium (Blutstaufe) in Neuss archäologisch
erwiesen. Das Zentrum des Isis-Kults dürfte Agrippina (Köln/D) gewesen
sein, wo sie als Myrionyma (Isis mit den 10.000 Namen) verehrt wurde.
Belege gibt es auch für die Verehrung des ägyptischen Himmels- und
Sonnengottes Ammon (meist mit Iuppiter gleichgesetzt) und dem
Iuppiter Dolichenus, der besonders beim Heer beliebt war. Von letzterem sind
Kultstätten in Vetera (Xanten-Birten/D), Agrippina
(Köln/D) und
Rigomagus (Remagen/D) identifiziert worden. Dargestellt wurde er mit
phrygischer Mütze, Doppelaxt und Blitzbündel in den Händen und auf
einem Stier stehend.
Der
wichtigste Mysterienkult in Untergermanien war der des persischen
Lichtgottes Mithras. Die Zahl der belegten Kultstätten ist jedoch bei
weitem nicht so gross wie in der Nachbarprovinz Germania superior. Die
Orte der Verehrung waren klein und einer Höhle nachgebildet, die das
Himmelsgewölbe darstellten. Interessant ist, dass bei einer Vergrösserung
der Gläubigen nicht die Kultstätte vergrössert, sondern eine neue
geschaffen wurde. Für Köln sind alleine drei Mithräen bekannt,
weitere in Belgica (zw. Euskirchen-Billig und -Rheder/D), Durnomagus
(Dormagen/) und Traiana (Xanten/D). Da der Kult der grösste Konkurrent
des Christentums war, wurden später alle Mithräen systematisch zerstört.
Die
ersten christlichen Gemeinden soll es in den germanischen Provinzen
bereits Ende des 2.Jh.n.Chr. gegeben haben. Die erste ergrabene
christliche Kirche ist für Köln unter dem heutigen Dom bezeugt; die
meisten aber waren Cellae Memoriae (Gedächtniskapellen) auf Friedhöfen.
Fast alle untergermanischen Kirchen hatten ihre Existenz solcher
Friedhofskapellen zu verdanken. Sie bildeten denn auch oft den Kern
der mittelalterlichen Städte, wohingegen die Römersiedlungen
aufgegeben wurden und heute in mancher städtischer Randlage zu finden
sind.
Grabbauten
mit entsprechender Ausstattung je nach dem Besitz des Toten sind für
die gallischen und germanischen Provinzen typisch. Besonders reich
sind Beigaben im gallisch-germanischen Grenzgebiet; wohingegen sie dem
Rhein hinauf wieder abnehmen. Gräber wurden konsequent ausserhalb der
Stadtmauern angelegt. Die Ausnahme Traiana (Xanten/D) rührt von sehr
alten Gräbern aus der Zeit vor der Stadtgründung her, wo es bloss
einige Gehöfte in der Gegend gab. In Köln konzentrierten sich die
Friedhöfe (mit einer Ausnahme von Gräbern vor der Siedlungsgründung)
um die Stadt an den Ausfallsstrassen. Ähnlich verfuhr man auch an den
anderen Orten.
An
Bestattungsarten kamen in Untergermanien sowohl Sepelire (zu Grabe
tragen) und Urere (verbrennen) vor, wobei letztere in den ersten
beiden nachchristlichen Jahrhunderten überwog. In der 2. Hälfte des
3.Jh.n.Chr. hatte sich die Körperbestattung endgültig durchgesetzt.
Die Kontinuität der Gräber auf den Friedhöfen reicht von der frühen
La-Tene-Zeit (ca. 300 v.Chr.) bis in die christliche Epoche. Dies kann
nur dadurch erklärt werden, dass sich die Bestattungsriten der
Germanen und Römer nicht wesentlich unterschieden haben dürften.
Viele
Gräber in Gallien und den germanischen Provinzen wurden reich mit
Beigaben versehen; vor allem bei Frauengräbern. Männer erhielten nur
dann Beigaben, falls sich in der Gegend keltisches Brauchtum erhalten
hatte, Werkzeuge und ähnliches Gerät mit ins Grab zu leben. Soldaten
gab man keine Waffen ins Grab, da diese nicht Privat- sondern
Staatseigentum waren. Echt römisch hingegen war die Beigabe von
Lampen, die dem Toten als Lichtquelle im Dunkel des Jenseits dienen
sollte.
Besonders
reiche Hügelgräber fand man im Gebiet westlich der mittleren und
unteren Maas, was auf starken keltischen Einfluss zurückzuführen
sein dürfte. Solche Bestattungen sind namenlos und entsprechen nicht
dem römischen Sinn nach Erinnerung durch die Nachfahren. So sind die
zahlreichen steinernen Grabmonumente das sichtbarste Zeichen der
Romanisierung der Provinz Untergermanien. Die ersten Grabsteine wurden
noch importiert; später entstanden entlang des Rheins zahlreiche
Werkstätten um den Bedarf zu decken. Immerhin machen Grabsteine den
grössten Fundbestand in Museen aus! Aus dem griechischen Raum wurden
schliesslich Hypogäen (unterirdische Grabkammern) übernommen, wovon
alleine in Agrippina (Köln/D) wenigstens neun nachgewiesen werden
konnten. Auch diese waren über die Jahrhunderte in Gebrauch.

Iuppiter-Säule
aus Bonna, 3.Jh.n.Chr.
e libro [habe ich mir leider nicht vermerkt...]
Sie wollen Fragen stellen, Anregungen
liefern oder sich beschweren?
Dann klicken Sie auf meine Kontaktseite!
(PL)